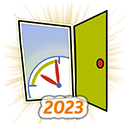246030 Punkte
diese Woche auf Platz
7
in Berlin
Seine Aktivitäten
-
grubmard kommentierte eine Bewertung zu Garmin Deutschland GmbH in Gräfelfing.
Vorsichtshalber habe meist einen altmodischen Autoatlas dabei ...
-
-
grubmard kommentierte eine Bewertung zu Garmin Deutschland GmbH in Gräfelfing.
Immer noch nicht. Alles eine Frage des Geldes, zumal ich auch ein neues Smartphone bräuchte, denn meins taugt nur noch als Handy und bei WLAN zu Hause für die Sparkassen-TAN, wenn ich mal eine brauche, denn der Speicherplatz ist fast ausgeschöpft.
-
grubmard kommentierte eine Bewertung zu Garmin Deutschland GmbH in Gräfelfing.
Ich weiß, hab aber kein mobiles Internet. Nur zu Hause Festnetzinternet.
-
-
-
 grubmard's Bewertung von Garmin Deutschland GmbH in Gräfelfing haben golocals als toll gemeldet, daher hat sie die golocal Grünedaumenvergabestelle ausgezeichnet!
grubmard's Bewertung von Garmin Deutschland GmbH in Gräfelfing haben golocals als toll gemeldet, daher hat sie die golocal Grünedaumenvergabestelle ausgezeichnet!
-
-
grubmard hat Garmin Deutschland GmbH in Gräfelfing mit 4 Sternen bewertet.Schade dass es die Dinger noch nicht gab, als ich beruflich viel in der DDR- und später bundesweit unterwegs war. Dieses ständige kaufen irgendwelcher Straßenkarten und Stadtpläne ist mir schon immer auf den Keks gegangen. Und mit der ... [komplett anzeigen] Schade dass es die Dinger noch nicht gab, als ich beruflich viel in der DDR- und später bundesweit unterwegs war. Dieses ständige kaufen irgendwelcher Straßenkarten und Stadtpläne ist mir schon immer auf den Keks gegangen. Und mit der Karte auf den Knien zu fahren war auch eher suboptimal.
Mit einem handschriftlichen Routenplan bin ich allerdings auch ans Ziel gekommen.
Nachdem die Navis auf den Markt gekommen waren, war ich unschlüssig, welcher Anbieter es denn sein sollte. Jedenfalls sollte es keins sein, wo das Kartenmaterial auf Deutschland und vielleicht noch auf Österreich und die Schweiz beschränkt war.
Meine Wahl fiel auf ein Garmin-Navi mit Kartenmaterial für Europa. Einige Länder waren damals nicht oder nur rudimentär mit einigen Hauptstraßen vorhanden.
Dieses Garmin führte mich einige Zeit zuverlässig durch Deutschland und angrenzende Länder, hatte aber keine Verkehrsinfo. Da ich es versäumt hatte, dass Gerät auf bei „Garmin Express“ zu registrieren, gabs natürlich keine kostenlose Kartenupdate’s, so dass es bei den Routen im Laufe der Zeit zu Ungenauigkeiten kam.
Also entschloss ich mich für ein neues Garmin – größeres Display, mit UKW-Verkehrsinfo und Europa-Kartenmaterial.
Auch dieses Gerät versah mehrere Jahre zuverlässig seinen Dienst – mit Anmeldung bei „Garmin Express“ und somit mit kostenlosen Karten-Updates.
Das „aus“ dieses Geräts kam abrupt während einer Tour durch brandenburgische Lande. Das Garmin navigierte nicht mehr und zeigte mir verwirrende und falschen Daten an (wie eine Geschwindigkeit von 235 kmh bei einem Auto dass bloß knapp 170 kmh schafft – siehe Foto).
Also musste Ersatz angeschafft werden, ein Garmin DriveSmart 60 mit Digitalradio-Verkehrsinfo und Europa-Kartenmaterial (Belarus und Moldau eingeschränkt / Das böse R-Land im Osten gar nicht - das war mir aber egal, da wollte ich damals nicht hin und will es heute erst recht nicht.).
Die Digitalradio-Verkehrsinfo (DAB) hat sich mehrmals als unzuverlässig herausgestellt, da die DAB-Versorgung in Deutschland noch nicht flächendeckend ist (Empfangslöcher).
Ansonsten funktioniert es ähnlich wie seine Vorgänger. Einige altbekannt Funktionen gibt es nicht mehr, dafür sind andere hinzugekommen.
Wie die Vorgängermodelle hat auch das DriveSmart 60 manchmal recht eigenwillige Vorstellungen was die Route betrifft.
Im Oderbruch hat es mich z.B. mal in die Pampa geschickt: die Ortsverbindungsstraße entpuppte sich trotz Ausschluss unbefestigter Straßen als Feldweg.
Im großen und ganzen bin ich aber zufrieden.
Dank Registrierung bei „Garmin Express“ komme ich in den Genuss Navi-lebenslanger Kartenupdate’s.
Da scheinbar immer der komplette Kartensatz heruntergeladen wird, braucht man dafür Zeit und Geduld. Das letzte Update benötigte ca. 90 Minuten.
Für den Einsatz losgelöst von der externen 12 V-Versorgung taugt es auch nur eingeschränkt. Der interne Akku ist ziemlich schwach auf der Brust und gibt auch schon mal den Geist auf, wenn das Gerät ausgeschaltet längere Zeit von der externen Stromversorgung getrennt ist.
Kleine Anekdote am Rande: Das Navi kann nicht nur Europa. Durch Zufall habe ich entdeckt, dass man auch eine Route von Berlin nach Kapstadt planen und berechnen kann (siehe Foto) oder in den USA von New York nach Los Angeles.
Zwar sind Adressen außerhalb Europas nicht im Datensatz vorhanden, aber durch Adresssuche und Antippen auf der Karte sind auch solche Eingaben möglich.
Allerdings hat die Berechnung Berlin (Deutschland)-Kapstadt (Südafrika) mehrere Stunden gedauert.
[weniger anzeigen]
-
grubmard kommentierte eine Bewertung zu toom Baumarkt München-Neuaubing in München.
Hast Du schon x-mal gesagt und hältst Dich aber einfach nicht an Deine eigenen Worte.
-
Mehr Neuigkeiten anzeigen